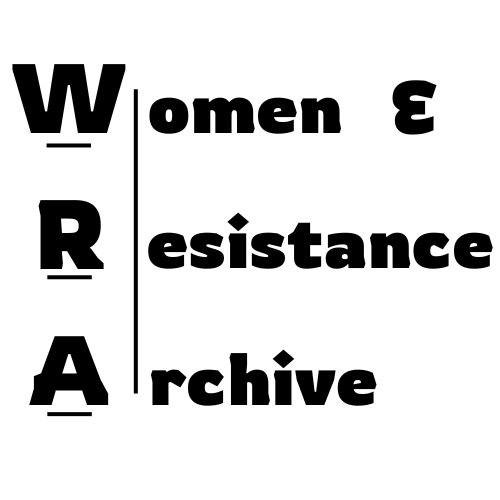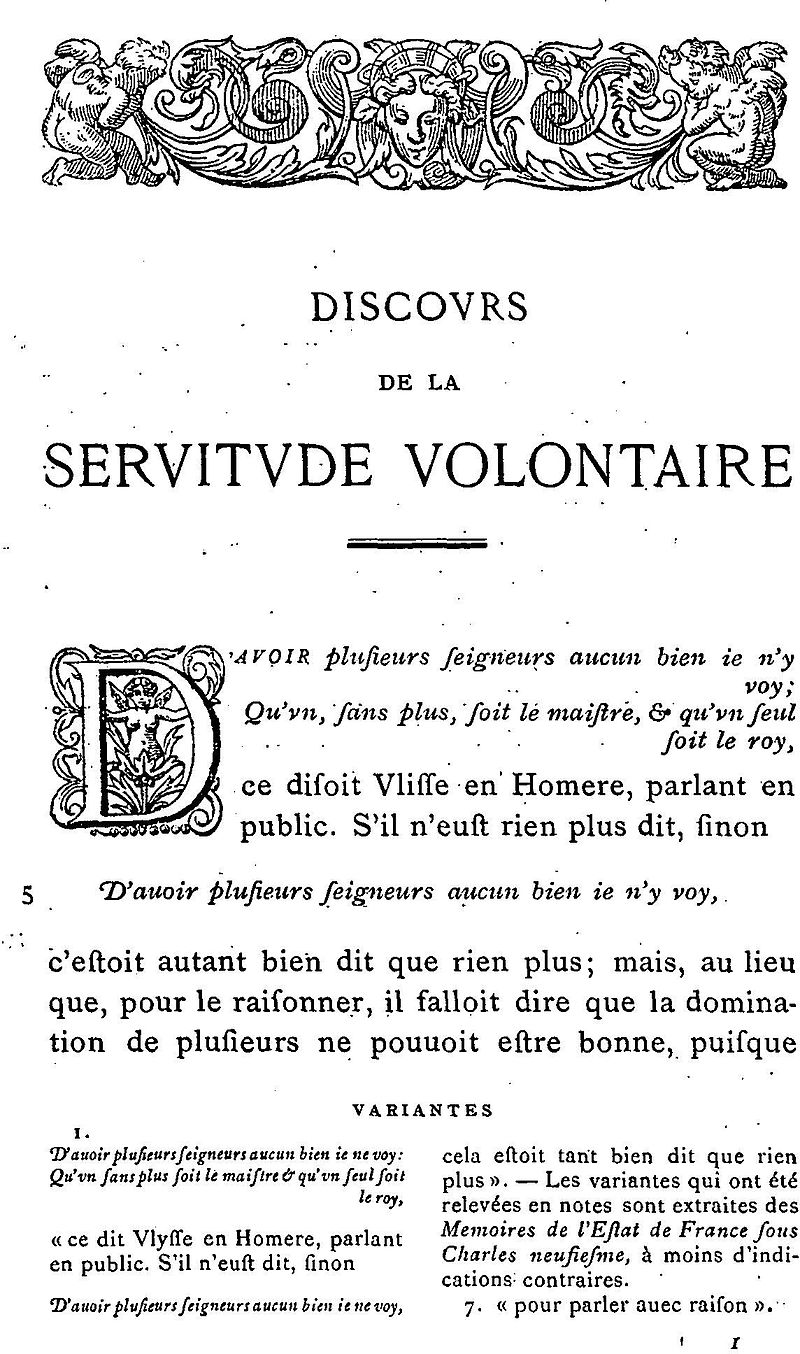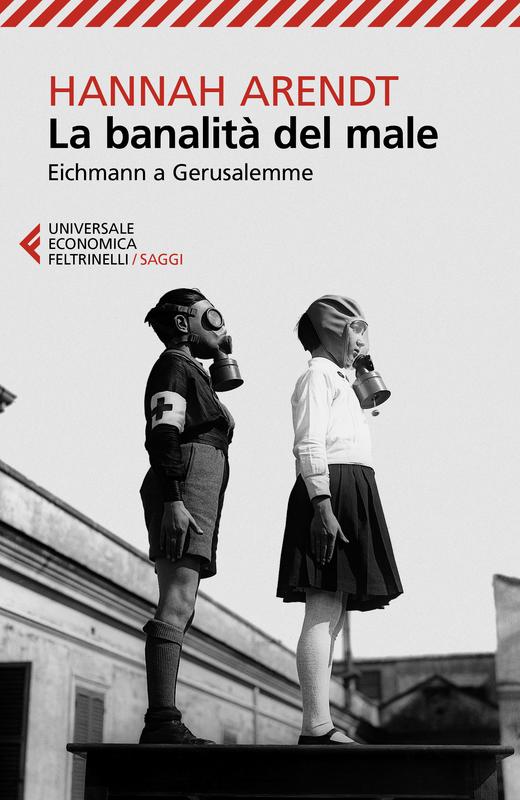Während des Krieges stellten Zeichen der Hilfe und Unterstützung zwischen Menschen – unabhängig von politischen Differenzen – eine Umgehung der Kontrolle des Regimes (bzw. der Regime) dar, das eine strikte Trennung zwischen Faschist:innen und Antifaschist:innen sowie Nationalsozialist:innen und Antinazis durchzusetzen versuchte. Durch die lückenlose Kontrolle des Alltagslebens zielten totalitäre Regime darauf ab, selbst die einfachsten Akte der Menschlichkeit zu unterbinden.
Hannah Arendt vertrat die Auffassung, dass der Totalitarismus den Menschen zum Denken unfähig machen wollte. In diesem Sinne ist bereits die Entscheidung, einer vom Regime verfolgten Person Essen, Wasser oder Medikamente zu geben, ein Akt des Widerstands gegen diese Entmenschlichung.
Auch wenn solche Handlungen nicht eindeutig unter dem Begriff „Widerstand“ erfasst werden können, so lassen sie sich ebenso wenig als Anpassung oder Konformität begreifen: Sie bewegen sich in einem Zwischenraum – zwischen Widerstand und erzwungener Anpassung an die Macht.